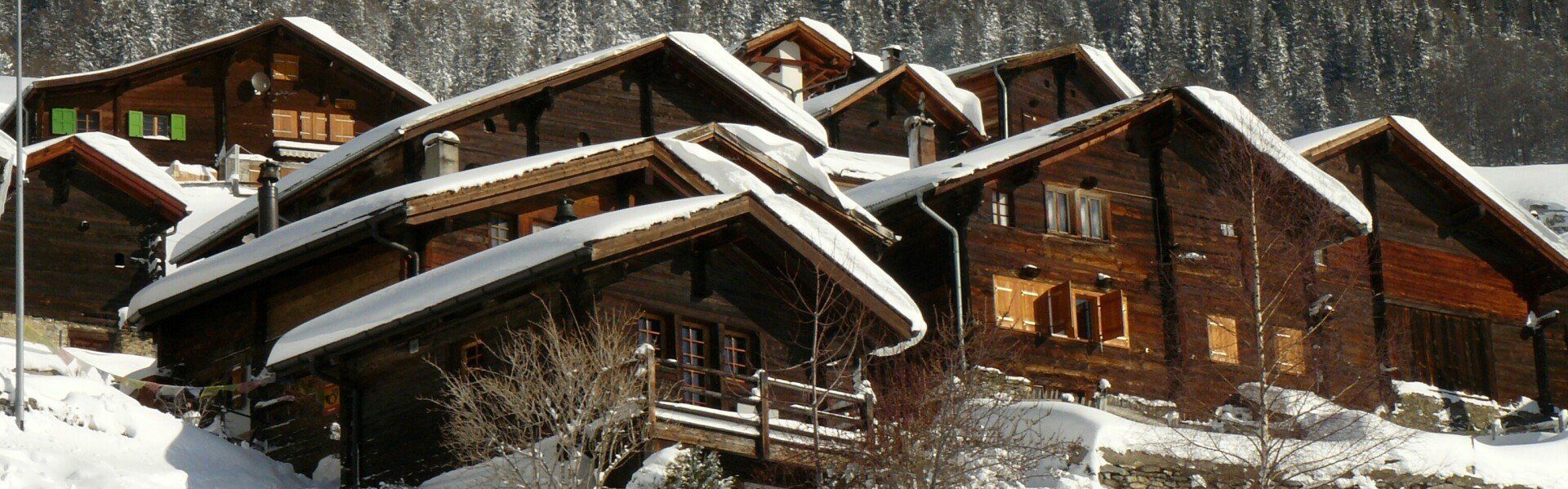DIALEKT- und NAMENKUNDLICHES
Ein paar Textproben zum Dialekt in Engersch, Jeizinen, in den Leuker Sonnenbergen, auf dem "Gnooggärbärg" finden Sie
hier
und
hier.
Viele Informationen zu den Walliser Dialekten finden Sie
hier.
Und hier einen lesenswerten Beitrag zur Oberwalliser Jagdsprache (aus dem Walliser Boten vom 24.10.2023).
Herkunft der Ortsnamen und der Bergnamen Niwen und Einigs Alichji
Der Hausberg von Engersch
Der Hausberg von Engersch hat gemäss der Karte 1 : 25 000 von Swisstopo (und auch, wenn man die Einheimischen fragt) zwei Namen: Niwen und Einigs Alichji (2769,2 m ü. M.).
Dass Berge zwei oder mehr Namen haben, kommt vor, wenn auch nicht oft. Ein (naheliegender) Grund kann sein, dass der Berg von seinen verschiedenen Seiten unterschiedliche Namen erhalten hat (ein Mittagshorn ist nur von einer Seite ein Mittagshorn). Warum unser Berg zwei Namen hat und welches der ältere ist, ist nicht bekannt.
Hingegen ist die Erklärung der beiden Namen einigermassen gesichert.
Relativ einfach ist die Erklärung für Niwen. Diese Benennung lässt sich zurückführen auf die Alp unterhalb des Niwen, die Niwenalp oder – Walliserdeutsch – Nibu Alpe, das heisst: „die neue Alp“. Der Berg ist demnach nach der Alp benannt – und nicht etwa umgekehrt, wie man heute oft vermutet. Früher hatten die Alpen Namen, die Berge kaum, und wenn, dann oftmals nach der Alp, über der sie sich erhoben. Bekannte Beispiele sind etwa im Berner Oberland der Mönch (nach der Mönchsalp) oder die Jungfrau (nach der Jungfrauenalp). Verwirrend, was die offenbaren Namenskonventionen von Swisstopo anbelangt, ist, dass sich auf der Karte sowohl die Schreibung Niwenalp (für die genaue Lokalität der Alphütte mit den Schafpferchen) wie auch Nibu (für das eigentliche Weidegebiet der Alp) finden, und dann wiederum Niwen für den Gipfel.
Schwieriger, und auch ein Stück weit spekulativ, ist die Deutung von Einig Alichji. Auffällig ist, dass der Name zweiteilig ist. Und in der Tat findet man in der Umgebung weitere Alichji, oder eigentlich Aliichji (Betonung auf dem anlautenden A und langes I). Diese andern Belege finden sich nicht auf der Karte von Swisstopo, aber in andern, genaueren Quellen: nämlich ein Meiggu Aliichji und ein Drii Aliichji. Der Name Aliichji allein kommt nicht vor. Meiggu ist eine Alp, und Drii heisst „drei“.
Aliichji ist also die Grundform, die in den Namen durch Attribute spezifiziert wird. Das Einig Aliichji wäre also das
alleinige Aliichji, neben dem dreifachen Aliichji und dem Aliichji bei der Meiggu Alpe.
Wie aber lässt sich Aliichji deuten? Eine einigermassen naheliegende Deutung ist die folgende. Wir fangen hinten an:
- -ji ist die im Walliserdeutschen allgemein bekannte Diminutivendung, das Pendant zu –lein. Hier liegt eine Palatalisierung des Diminutivsuffixes /-li/ zu /-ji/ vor. Vgl. Mannji (Männlein) oder Meitjie (Mä(g)dlein).
- liich kann man deuten als "gleich", und das A als Überbleibsel einer Form Ma(nn).
- Zusammengefasst ergäbe das etwa Folgendes: Aliichji bedeutet "kleines Mann/Mensch-Ähnliches". Es könnte auf Steinmännchen hinweisen, die seit Urzeiten und sehr oft als Weg- und Gipfelmarkierungen verwendet wurden und werden. Das Einig Aliichji wäre also der Gipfel, auf dem ein einzelnes Steinmännchen steht, das Drij Aliichji der Ort, an dem drei Steinmännchen stehen, und das Meiggu Aliichji der Ort oberhalb der Meiggu Alpe, wo das Steinmännchen steht.
Das Einig Aliichji wäre damit ein Namensvetter des viel berühmteren Männlichen im Berner Oberland und vieler anderer Gipfelnamen mit dem Element Mann/Mensch.
Zur Sprachgrenze zwischen dem deutsch- und dem französischsprachigen Wallis
Zweifellos ist der Name Einig Aliichji deutsch, alemannisch. Das ist insofern nicht selbstverständlich, als die Namen der Siedlungen in der Umgebung zumeist französischen, genauer franko-provenzalischen Ursprungs sind (wobei einige allerdings noch älteren, vorromanischen, Ursprungs sind, aber romanisiert wurden). Der Bezirk Leuk als der westlichste Teil des deutschsprachigen Oberwallis wurde erst spät, im 15. oder sogar erst im 16. Jahrhundert germanisiert. Zu dieser Zeit bestanden die Wohnsiedlungen alle schon, hatten franko-provenzalische Namen, die dann germanisiert wurden. Anders die Berge: Sie hatten noch keine Namen, oder jedenfalls nicht so gebräuchliche, dass sie von den einwandernden Alemannen übernommen und germanisiert worden wären. Die späte Germanisierung des Bezirks Leuk im 15. und 16. Jahrhundert ging übrigens über die heutige Sprachgrenze von Pfynwald und Raspille hinaus und über Siders/Sierre hinweg westwärts bis nach Sitten/Sion (Sieg des deutschsprachigen Oberwallis auf der Planta 1475 über das franko-provenzalische Unterwallis). Sitten und Siders waren dann lange Zeit zweisprachige, sogar dominant deutschsprachige Städte, natürlich vor allem wegen der Herrschaft des deutschsprachigen Oberwallis über das französischsprachige Unterwallis. Nach dem Ende des Ancien Régime (in der Schlacht im Pfynwald 1799) und damit der Oberwalliser Herrschaft über das Unterwallis ging die Sprachgrenze langsam wieder ostwärts zurück. In den 1950er-Jahren war Siders/Sierre noch praktisch eine zweisprachige Stadt, mit einem französischen und einem deutschen Gottesdienst am Sonntag. Heute gibt es noch eine bedeutende deutschsprachige Minderheit in Siders/Sierre.
Sitten/Sion ist weitgehend eine französischsprachige Stadt geworden.
Zu den Siedlungsnamen in der Umgebung des Einig Aliichji
Engersch: Ausgesprochen Änggersch. Die historischen Belege zeigen eine Form Ancheres (ältester Beleg: 1337); die 'eingedeutschte' Form Enkers ist erstmals 1385 belegt ("enkers seu ancheres", also so viel "Ancheres, zu deutsch Enkers"). Es handelt sich also sicher um einen "eingedeutschten" romanischen Namen; darauf weist auch das Endungs-s hin, vermutlich eine romanische Plural-Endung; dieses wird dann im Walliserdeutschen zu /-sch/ wird. Das Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch deutet den Namen (vermutungsweise) wie folgt: Der Name kommt vom romanischen Wort anche, das so viel wie "Schenkel" bedeutet. Vermutungsweise geht der Name also auf so etwas wie "zwei Schenkel (eines Weges)", also eine Weggabelung, eine Wegscheide zurück. Mit Blick auf die alten Wege in Engersch ist das keineswegs abewegig: Steigt man von Bratsch oder Erschmatt hoch nach Engersch, so gabelt sich dort der Weg mehrfach: Richtung Jeizinen, Richtung Feselalp, Richtung Niwenalp, Richtung Brentschen.
Bratsch: Der Name geht klarerweise auf das lateinische pratum, genauer die Pluralformen pratas / prades ("Wiesen") zurück.
Erschmatt: Die Einheimischen sagen noch heute
Ersch, und sehr lange Zeit ist der Ortsname ohne das neuere
matt
(Matte, Wiese)
belegt. Erstmals erwähnt 1209
Huers. Der Name geht möglicherweise auf das spätlateinische Wort
wersicus „krumm“ zurück, wobei unklar ist, wie die Benennung zu erklären ist. Wer heute auf der Strasse von Bratsch via Erschmatt nach Engersch hochfährt, erkennt unschwer, dass die Strasse hier eine grosse Schlaufe (Krümmung) durch das Dorf macht. Aber war das früher auch so?
Brentschen: Ausgesprochen Bräntschen. Das Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch vermutet auch hier einen romanischen Ursprung und einen Zusammenhang zu Brentjong (ausgesprochen Bräntjong) oberhalb von Leuk, wo heute die Satellitenstation steht. Die Deutung ist schwierig. Der Name könnte mit der Bränta zusammenhängen, einem weit verbreiteten und vermutlich aus dem Italienischen stammenden Wort (brinta) für ein Rückentraggerät.
Jeizinen: Ältester Beleg von 1275 Jouczana, dann 1332 iolzana und 1333 Jouzana usw. Deutung unklar.
Gampel: Erstmals erwähnt 1238 champilz. Zweifellos eine Ableitung von lateinisch campus „Feld“ bzw. campile „in Wiese umgewandeltes Feld, das im Vorjahr gepflügt wurde“.
Quellen:
Iwar Werlen: Die Grundwörter der Oberwalliser Gipfelnamen. In: Chomolangma, Demawend und Kasbek, Festschrift fur Roland Bielmeier (2008), 577–614
Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch. Hrsg. v. Iwar Werlen. 2024
Siehe auch die Website des Vereins für das Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch.